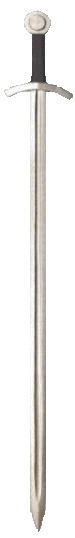Verbrechen rund um die Alchimie
Auf den ersten Blick hat unsere heutige Regierung mit den deutschen Regierungen des 15. - 17. Jahrhunderts nicht das mindeste gemeinsam. Doch etwas scheint schon damals so gewesen zu sein und sich bis heute nicht geändert zu haben: Die Ausgaben der jeweiligen Regierungen gehen weit über ihre Einnahmen hinaus. Doch statt nach Wegen zum Sparen wird damals wie heute ständig nach neuen Geldquellen gesucht. Spätestens seit Beginn des 15. Jahrhunderts entdeckten die deutschen Fürstenhäuser dabei die Alchimie für sich, genauer gesagt den Teil der Alchimie, der sich mit der Gewinnung von Gold aus unedleren Metallen beschäftigt.
Ausgelöst wurde dieses Interesse in Deutschland durch Berichte angeblicher Erfolge z. B. aus England, wo der Alchimist Raymundus Lullus im Jahre 1332 König Eduard II. für einen geplanten Kreuzzug sechzigtausend Pfund Gold gemacht haben soll. Bald häuften sich auch hierzulande die Berichte von angeblichen Erfolgen der Wissenschaft und der Existenz künstlich hergestellten Goldes. Im Laufe der Zeit gab es kaum noch einen deutschen Fürstenhof, an dem die Kunst der Alchimie nicht praktisch oder doch zumindest theoretisch betrieben wurde.
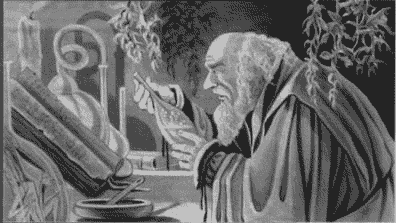
Schnell versuchten Betrüger, dieses Interesse der Fürsten an der
Alchimie für sich zu nutzen. Sie tauchten im Umfeld der Höfe auf und
erweckten durch allerlei Taschenspielertricks den Anschein, den Stein der Weisen
entdeckt zu haben, also die Kunst des Goldmachens zu beherrschen. Die erfolgreichsten
dieser Betrüger boten sich dabei nicht direkt dem Regenten an, sondern sie
warteten geduldig, bis die Erzählungen über ihre angeblichen Wundertaten
den Fürsten über Umwege erreichten. Trat dieser dann von sich aus an den
vermeidlichen Retter aus seinen finanziellen Nöten heran, so ließ sich der
Goldmacher zunächst einmal eine Weile bitten und in dieser Zeit natürlich
fürstlich bewirten.
Danach kam die eigentliche Zeit des Betrügers: Er ließ den Regenten
wissen, er sei ja guten Willens, aber er müsse zunächst einiges in die
Ausstattung eines guten Labors investieren. Nur dann könne er später auch
in größeren Mengen künstliches Gold herstellen.
Dem Betrüger ging es selbstverständlich darum, diese erste Zeit, in der er den Fürsten immer wieder leicht zu größeren Investitionen in den zu erwartenden Reichtum animieren konnte, möglichst lange andauern zu lassen. Doch irgendwann wurde die Ungeduld am Hofe doch zu groß, und nun musste er eine Probe seines Könnens geben, also die Verwandlung unedler Metalle in Gold vorführen.
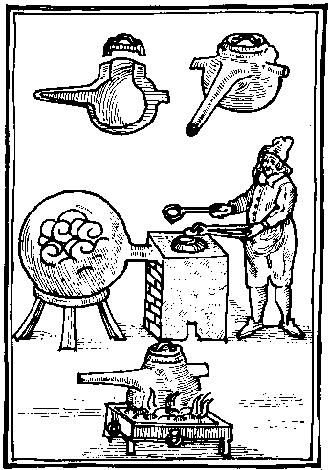
Hier gab es einige Möglichkeiten, den Fürsten und sein Gefolge zu täuschen. Die plumpsten Tricks beruhten auf der Zugabe von chemischen Substanzen, die die Verwandlung der Farbe des unedlen Metalls in Goldgelb bewirkten. Klar ist jedoch, dass diese Methode einer genaueren Überprüfung nicht standhalten konnte. Schon besser war der umgekehrte Weg, echtes Gold mit Hilfe chemischer Substanzen mit einer Farbschicht zu überziehen, die es wie unedleres Metall, etwa Silber oder Kupfer, wirken ließen. Bei der Vorführung am Fürstenhof wurde diese Schicht durch Erhitzen zum Verschwinden gebracht und das reine Gold kam wieder zum Vorschein. Eine Substanz, mit der dieser Trick funktioniert hat, soll Quecksilber gewesen sein. Die meisten angeblichen Goldmacher arbeiteten jedoch mit einer einfacheren Methode. Sie ließen die unedlen Metalle in einem Gefäß schmelzen und mogelten dabei das Gold mit hinein. Möglich war dies, indem etwa das Gefäß vorher mit einem doppelten Boden versehen wurde, unter dem sich das Gold befand. Wurde dieser Boden dann beim Erhitzen durchstoßen, so vermischte sich das versteckte Gold mit dem übrigen flüssigen Metall im Gefäß. Andere Betrüger benutzten einen Rührstab mit einer mit Wachs verschlossenen Aushöhlung, in der sich das Gold befand. Oder sie deckten das Gefäß beim Erhitzen mit einer Platte ab, ebenfalls mit einer mit Wachs verschlossenen, mit Gold gefüllten Aushöhlung. Das Ergebnis war in allen Fällen gleich: Nach dem Erhitzen war in der Probe Gold nachweisbar, der Betrüger hatte den Fürsten zunächst von seinem Können überzeugt. Außerdem hatte er neue Zeit gewonnen, die er angeblich brauchte, um die Goldmenge durch wiederholtes Erhitzen noch zu erhöhen und anschließend das reine Gold herauszufiltern.
Doch all diese Tricks hatten natürlich denselben entscheidenden Fehler: es wurde kein einziges Gramm Gold wirklich gewonnen, sondern der Betrüger musste im Gegenteil eigenes Gold investieren. Deshalb konnte er die Rolle des Goldmachers nicht allzu lange glaubhaft vorspielen. Jetzt galt es, den richtigen Moment zur Flucht zu finden, also den Moment, an dem man den Fürsten so weit wie möglich ausgenommen hatte, aber auch noch niemand im Umfeld des Fürsten den angeblichen Goldmacher offen des Betruges beschuldigte. Aber viele verpassten in ihrer Gier diesen richtigen Zeitpunkt zur Flucht und fanden sich plötzlich vor Gericht wieder. In den meisten Fällen geschah dies auf Betreiben des Landesherrn selbst, dem schließlich doch der Verdacht kam, er könnte einem Betrüger aufgesessen sein. Es gab jedoch auch Fälle, in denen die Handwerks-Stände des Landes angesichts der immensen Ausgaben des Fürsten für seinen Hofalchimisten letztendlich die Notbremse zogen, ihn hinter dem Rücken des Herrschers verhaften und ihm den Prozess machen ließen.
Da der Goldmacher niemals einen objektiven Beweis seines angeblichen Könnens liefern konnte, endeten diese Gerichtsverfahren fast immer gleich: mit einer Verurteilung wegen Betruges zum Tod am Galgen.
Über solche betrügerischen Hofalchimisten wurde in Deutschland ab dem 15. Jahrhundert immer wieder berichtet. Aber während sich diese Betrüger freiwillig in Gefahr begaben - und meistens auch darin umkamen - gab es ab dem frühen 17. Jahrhundert auch eine andere Form des Verbrechens um das künstliche Gold, bei dem eigentlich der Fürst der Täter und der angebliche Alchimist das Opfer war. Diese Verbrechen beruhten auf der einen Seite auf der ständig weiter wachsenden Pracht- und Prunksucht der Herrscher, die sich gegenseitig zu überbieten suchten mit immer prächtigeren Gewändern und Schmuck, mit immer mehr Hofstaat sowie Armeen und letztendlich auch mit immer größeren, aufwändigeren Bauwerken. Kaum einer konnte sich dem entziehen, und so befanden sich die meisten deutschen Fürstenhäuser in permanenter akuter Finanznot. Andererseits spielte auch der gewachsene Absolutheitsanspruch der Herrschenden eine entscheidende Rolle: Das Wohl des Volkes war gleichbedeutend geworden mit dem Wohl ihres Fürsten, wer seinen Interessen entgegenstand oder sich ihm widersetzte, machte sich allein dadurch schon strafbar. So lief schließlich schon Gefahr, wer den Glauben des Herrschers an die Alchimie öffentlich anzweifelte, obwohl dieses "Verbrechen" wohl nur selten ernsthaft verfolgt wurde. Wirklich gefährlich aber wurde es, wenn der Eindruck entstand, jemand hätte den Stein der Weisen entdeckt, würde sein Wissen seinem Landesvater aber pflichtwidrig vorenthalten. Man glaubte, sich dieses Goldmachers mit allen Mitteln bemächtigen zu dürfen, ihn gefangen zu nehmen und über längere Zeit in Gefangenschaft halten zu können. Dies einerseits, um den scheinbar Unwilligen an der Flucht zu hindern und ihn zu zwingen, sein Geheimnis preiszugeben. Andererseits aber insbesondere auch deshalb, weil unter den Herrschern ein regelrechter Wettbewerb um die Alchimisten ausgebrochen war. Man wollte auf jedem Fall verhindern, dass sich ein konkurrierender Fürst des angeblichen Goldmachers bemächtigen konnte und ließ ihn deshalb streng bewachen. Auch scheute man nicht davor zurück, mit Tortur und Folter nachzuhelfen, damit sich der Gefangene möglichst schnell und erfolgreich auf seine Kunst besinnen möge. Der Egoismus und die Maßlosigkeit der Herrscher kannte hierbei zum Teil keine Grenzen, so dass spätestens ab 1603 auch Fälle bekannt wurden, in denen der Alchimist schließlich an den Folgen der Folter verstarb. Spätestens ab diesem Zeitpunkt konnte sich also niemand mehr seines Lebens sicher sein, sobald er in den Verdacht geriet, möglicherweise ein erfolgreicher Goldmacher zu sein.
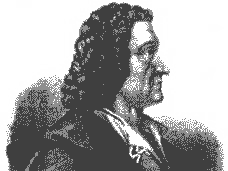
Johann Friedrich Böttger
Schon als Kind zeigte er großes Interesse an der Chemie, und so wurde er als Zwölfjähriger von seinen Eltern nach Berlin in eine Apotheker-Lehre gegeben. Er soll ein ehrlicher, fleißiger Laborant gewesen sein mit großem Lerneifer. Als Apotheker-Lehrling machte er erste chemische Experimente, und fast zwangsläufig bekam er auch erste Einblicke in die Alchimie, die ja bis heute in der Homöopathie eine wichtige Rolle spielt. Entgültig erwachte sein Interesse für die Alchimie, als er Kontakt bekam zu einigen bedeutenden Alchimisten um den Staatsrat von Haugwitz.
In den Jahren nach seiner Lehrzeit beschäftigte sich der Apotheker
Böttger viel mit experimenteller Alchimie. Wahrscheinlich versuchte er sich auch
- allerdings erfolglos - in der Kunst der Goldherstellung. Doch Böttger muss
wohl ein etwas zu gutgläubiger Mensch gewesen sein, jedenfalls beschränkte
er seine Kontakte zunehmend nicht mehr nur auf angesehene Alchimisten. Vielmehr gab
er sich immer öfter auch mit den betrügerischen Alchimisten ab, die
natürlich auch in Berlin anzutreffen waren. Einer dieser Betrüger hat dann
das Gerücht in die Welt gesetzt, er selbst habe gemeinsam mit Böttger
künstliches Gold hergestellt. Wie vom Betrüger geplant, kam diese
Geschichte bald auch dem preußischen König Friedrich I. zu Ohren. Aber
jetzt ging der Plan gründlich schief: Der König machte nicht etwa den
Geschichtenerzähler zu seinem neuen Hofalchimisten, sondern er ordnete im Jahre
1701 die Gefangennahme des Apothekers Johann Friedrich Böttger an.
Anschließend wollte er in einem inquisitorischen Verfahren klären lassen,
ob der Gefangene ein erfolgreicher Goldmacher oder ein Betrüger sei. Das
Gerücht von seiner bevorstehenden Verhaftung erreichte Böttger gerade noch
rechtzeitig. Er verließ seine Apotheke und hielt sich zunächst in Berlin
versteckt. Doch dann ließ der König Friedrich überall in der Stadt
Anschläge aushängen, in denen er 1000 Taler Belohnung auf die Ergreifung
Böttgers aussetzte. Daraufhin floh dieser im Oktober 1701 nach Wittenberg in
Sachsen, wo er Medizin studieren wollte. Aber auch hier war er nicht sicher. Denn
durch ein Auslieferungsgesuchen aus Preußen erfuhr der nicht minder
geldbedürftige sächsische Kurfürst und polnische König August der
Starke von dem angeblichen Goldmacher. Im Februar 1702 ließ er Böttger
gefangen nehmen, nicht etwa, um ihn an den preußischen König auszuliefern,
sondern um ihn nun seinerseits für seine Zwecke auszunutzen. Das folgende Jahr
verbrachte Böttger in Haft, zunächst in Dresden, dann im Hause des
Fürsten von Fürstenberg, schließlich in der Festung Königstein -
aber immer unter strenger Bewachung sächsischer Truppen, deren Offizier
persönlich bei Verlust von Leben und Ehre für die sichere Unterbringung des
Gefangenen verantwortlich gemacht wurde. Einige in dieser Zeit durchgeführte
Experimente zur Goldherstellung schlugen fehl. Da jedoch der preußische
König weiter auf die Auslieferung Böttgers drängte, kam August der
Starke nicht etwa zu dem Schluss, der angebliche Goldmacher sei in Wirklichkeit nur
ein weiterer Betrüger. Er war im Gegenteil immer fester von der Fähigkeiten
Böttgers überzeugt und rang sich zu der Erkenntnis durch, die strengen
Haftbedingungen könnten den Erfolg des Alchimisten behindern. Daraufhin
ließ er Böttger zurück nach Dresden bringen, wo er nun mit
Annehmlichkeiten und Gunstbezeugungen des sächsischen Kurfürsten
überhäuft wurde. Doch seine Freiheit erhielt er natürlich nicht
zurück, und Böttger war sich bewusst, dass diese Fürsorge des
Fürsten jederzeit wieder ins Gegenteil umschlagen konnte, wenn er die in ihn
gesetzten Erwartungen weiterhin nicht erfüllen würde.
Unter diesem Druck wurde Böttger nun tatsächlich zum Betrüger. Er
erklärte sich bereit, für den Kurfürsten künstliches Gold
herzustellen. Dafür ließ er sich von August dem Starken tausend Dukaten
für die Einrichtung seines Laboratorium aushändigen und rang ihm das
Versprechen ab, die Haft werde aufgehoben, sobald seine Experimente den
gewünschten Erfolg zeigten.
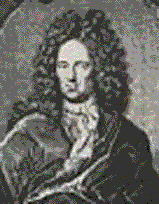
Graf von Tschirnhausen
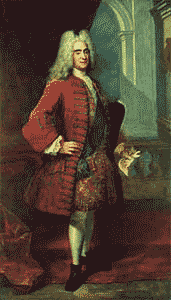
König August II,
August der Starke
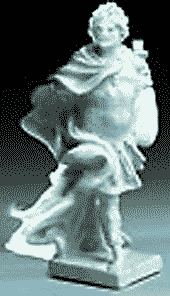
August als Pozellanfigur
Mit diesem Erfolg im Rücken wagte es Böttger, August einzugestehen, dass er im Goldkochen wohl immer ein hoffnungsloser Fall bleiben würde, der wohlwollend gestimmte Kurfürst verzieh ihm. Nach dem plötzlichen Tod von Tschirnhausens im Jahr 1708 machte er Böttger zum Leiter der Porzellan-Manufaktur in Dresden, 1710 ernannte er ihn schließlich zum Direktor der neu gegründeten Königlich-Sächsischen Porzellan-Manufaktur in Meißen. Aber erst im Jahr 1715 nach mehr als zwölfjähriger Gefangenschaft erhält Böttger auch seine Freiheit zurück, nachdem er den Kurfürsten überzeugen konnte, dass er das Land nicht mehr verlassen und auch das Geheimnis der Porzellanherstellung niemandem verraten würde.
Böttger starb am 13. März 1719 in Dresden nach langer Krankheit. Die vielen chemischen Experimente - manche sagten auch der Alkohol - hatten seine Gesundheit zerstört.
19. 9. 2003
Petra Hannebauer
Quelle: Gustav Radbruch / Heinrich Gwinner "Geschichte des Verbrechens"
K. F. Koehler Verlag Stuttgart, 1951