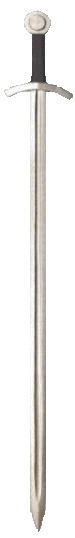Ulrich von Württemberg
Charles wiederum ehelicht Lady Diana und zeugt mit ihr 2 Kinder, aber über all diese Jahre hinweg führt er seine Beziehung zu Camilla fort ...

Ulrich von Württemberg
Das Leben des Ulrich von Württemberg stand von Beginn an unter keinem guten
Stern. Am 8. Februar 1487 geboren, stirbt seine Mutter wenige Tage später an den
Folgen dieser Geburt. Sein Vater ist zu diesem Zeitpunkt schon merklich geisteskrank,
und so kommt der Junge im Alter von 2 Wochen in die Obhut des damaligen Herzogs von
Württemberg, ein Cousin des leiblichen Vaters.
Der Herzog nimmt den Jungen an Kindes statt an, aber wohl nicht aus echter Zuneigung,
sondern nur, um die Erbfolge des Hauses Württemberg zu sichern. Ulrich wird von
Erzieher zu Erzieher weitergereicht und er entwickelt sich zu einem dicken,
wehleidigen - wahrscheinlich einfach unglücklichen - Jugendlichen. Seine
nächsten Erzieher versuchen dem entgegen zu wirken mit eiserner Disziplin, auf
seinem Stundenplan stehen ab jetzt Kriegsführung statt Latein und Musik, sowie
Reiten und Jagen als einem zukünftigen Herzog angemessene Sportarten. Und vor
allem an der Jagd scheint der junge Ulrich wirklich Gefallen gefunden zu haben, wie
zeitgenössische Quellen berichten.
Im Jahre 1498, Ulrich ist also jetzt 11 Jahre alt, wird er mit der sechsjäährigen Sabine von Bayern verlobt. Die Verlobung erfolgt auf Initiative ihres Onkels, des damaligen Kaisers Maximilian I, und wird mit einem Heiratsvertrag besiegelt.
In den folgenden Jahren wächst Ulrich zu einem einigermaßen stattlichen
jungen Mann heran, der sich mittlerweile auch bei Hofe angemessen zu benehmen
weiß. Im Alter von 16 Jahren kann er dadurch Kaiser Maximilian überzeugen,
ihn für volljährig zu erklären. Damit übernimmt er von seinem
einige Jahre zuvor verstorbenen Adoptivvater das Herzogtum Württemberg.
Sein Volk steht dem jungen Herzog zunächst sehr wohlwollend gegenüber, aber
die positiven Erwartungen werden schnell enttäuscht. Dies liegt vor allem an
Ulrichs katastrophaler Wirtschaftspolitik. Er treibt die Steuern in seinem Land
derart in die Höhe, dass vor allem das niedrigere Volk über kurz oder lang
an den Rand des Ruins gerät.
Irgendwann in dieser ersten Zeit seiner Regentschaft lernt Ulrich von
Württemberg Ursula, die Tochter seines Hofmarschalls Konrad Thumb von Neuburg,
kennen und lieben. An dieser Liebe änderte sich auch in den nächsten Jahren
nichts, häufig besucht er sie im Haus ihres Vaters.
Doch sein Heiratsvertrag mit Sabina von Bayern ist bindend, und ein Zerwürfnis
mit dem Kaiser will er damals nicht riskieren. So wird im März 1511 in Stuttgart
die Ehe zwischen Ulrich und Sabina geschlossen. Glücklich wird der Herzog mit
seiner Braut wohl nie gewesen sein, ist sie doch sowohl äußerlich als auch
vom Wesen her das Gegenteil seiner geliebten Ursula: Sabina von robuster Figur,
burschikos, aufbrausend, eigenwillig und mit scharfer Zunge, Ursula hingegen zart und
fraulich, äußerst charmant und liebenswürdig.
Jedenfalls setzt er seine regelmäßigen Besuche bei Ursula auch nach seiner
Hochzeit unverändert fort. Daran änderte sich auch nichts, als sie
schließlich ebenfalls heiratete. Ihr Ehemann Hans von Hutten dient seit vielen
Jahren als Stallmeister am Hof des Herzog, längst sind Ulrich und er
unzertrennliche Freunde geworden.
Diese Freundschaft zerbricht, als Hans von Hutten den Herzog wegen der häufigen
Besuche bei seiner Frau zu Rede stellt und droht, mit seiner Frau Stuttgart für
immer zu verlassen. Ulrich von Württemberg reagiert hierauf für einen
Herzog ziemlich unangemessen: Er kniet vor seinem Stallmeister nieder und fleht ihn
an "zu gestatten, seine eheliche Hausfrau weiter lieben zu dürfen, er
könne, wolle und möge es nicht lassen". Hans von Hutten lehnt dieses
Ansinnen natürlich ab. Er verpflichtet sich aber gegenüber seinem Herzog,
über den peinlichen Vorfall Stillschweigen zu bewahren.
Doch schon bald kommt Ulrich von Württemberg zu Ohren, dass Hans von Hutten
dieses Versprechen gebrochen und die Geschichte sowohl im Freundes- als auch im
Verwandtenkreis herumerzählt hat, so dass sie mittlerweile am ganzen Hof bekannt
ist. Dadurch fühlt sich der Herzog nicht nur gedemütigt, sondern auch
lächerlich gemacht, was er als Angriff auf seine Ehre empfindet. In
unbändiger Wut stellt er seinen Stallmeister zunächst öffentlich zur
Rede, er nennt ihn einen "treulosen, verräterischen Fleischbösewicht, der
so übel an ihm gehandelt habe wie Judas an seinem Herrn".
Hans von Hutten ahnt, dass sich die Wut des Herzogs nicht so bald legen würde.
Auch auf Anraten seiner besorgten Familie bittet er deshalb am 6. Mai 1515 um seine
Entlassung. Doch statt über dieses Entlassungsgesuch zu entscheiden, lädt
Ulrich ihn ein zu einem Jagdritt in den Böblinger Forst am folgenden Tag. Trotz
einiger Bedenken stimmt Hans von Hutten zu.
Am Morgen des 7. Mai 1515 erscheint der Herzog gepanzert und wohlgerüstet,
Hans hingegen nur mit einem Degen bewaffnet auf einem kleinen, unscheinbaren
Pferdchen. Während des Ritts schickt Ulrich alle seine anderen Begleiter voraus,
so dass er schließlich mit seinem ehemaligen Freund Hans von Hutten alleine
zurück bleibt.
Wahrscheinlich kommt es nun erneut zum Streit zwischen den beiden Männern.
Jedenfalls erhebt Ulrich von Württemberg plötzlich sein Schwert gegen
seinen quasi wehrlosen Stallmeister. Hans von Hutten stirbt an mehreren Stichwunden,
von denen einige von hinten zugefügt wurden - offensichtlich hat er noch
versucht, auf seinem kleinen, langsamen Pferd vor dem gut berittenen Herzog zu
fliehen.
Nach der Tat schlingt Ulrich dem Toten einen Gürtel um den Hals und knüpft
diesen an einen Degen, den er anschließend so in den Boden rammt, dass es
aussieht, als sei Hans von Hutten mit diesem Gürtel erhängt worden.
Dazu muss man wissen, dass der Galgen damals eine ehrlose Strafe bedeutete, eine
Strafe, von der Adelige - wie es ja auch Hans von Hutten war - grundsätzlich
verschont blieben. Heutzutage ist es schwer vorstellbar, aber damals löste die
"Begnadigung" eines zum Tode Verurteilten vom Tod am Galgen zum Tod durch Enthaupten
bei diesem und seinen Angehörigen überschwängliche Freude und
Dankbarkeit aus. Denn während Gehängte nach ihrem Tod einfach irgendwo
verscharrt wurden, manchmal zur Abschreckung auch zunächst einmal einfach
hängen gelassen wurden, sicherte der Tod durch Enthaupten ein ehrbares
Begräbnis.
Ulrich von Württemberg wollte durch diese Tat also Hans von Hutten im Tod noch
entehren, so wie dieser ihn zuvor entehrt hatte.
Angehörige der Jagdgesellschaft, die den Toten schließlich finden,
berichten, dass Ulrich seine Tat zunächst für vollkommen gerechtfertigt
hält. Als Herzog war er auch oberster Richter über sein Volk, und seiner
Meinung nach hatte er die gerechte Strafe über Hans von Hutten verhängt und
vollstreckt.
Doch sowohl der Adel als auch das einfache Volk in Deutschland sieht dies anders.
Schnell wird die Geschichte im ganzen Land bekannt und löste überall
Abscheu, Entsetzen und Empörung aus. 18 Grafen und Edle sagen sich nach der Tat
aus seinen Diensten los. Seine Frau Sabina verlässt ihn, womit Ulrich nun ihre
Brüder, Herzöge in Bayern, und insbesondere auch ihren Onkel, Kaiser
Maximilian, als Gegner hat.
Der Kaiser erklärt Ulrich von Württemberg schließlich im Jahr 1516
zum Geächteten. Er muss sein Land für 6 Jahre verlassen und einem vom
Kaiser eingesetzten Regierungsrat überlassen. Weiter muss er an die Familie des
ermordeten Hans von Hutten eine Entschädigung zahlen, erst danach wird die
Ächtung wieder aufgehoben.
Ulrich von Württemberg versucht zunächst, dieser seiner Strafe zu
entgehen, indem er seine Bauern zu einem Aufstand gegen den Kaiser aufwiegeln will.
Doch diese Idee kann eigentlich nur als weiteres Indiz dafür gewertet werden,
dass der Herzog sich ein vollkommen falsches Bild von der Realität machte. 2
Jahre zuvor hatte er einen Aufstand seiner unzufriedenen Bauern mit
äußerster Brutalität niederschlagen lassen. Und nun versucht er also,
eben diese Bauern zu einem neuen Aufstand - diesmal sogar gegen den Kaiser -
anzustacheln.
Dieser Plan ist natürlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt, so dass sich
Ulrich schließlich dem Kaiser beugen und sein Land verlassen muss.
Nach seiner Rückkehr aus der Acht setzt Ulrich von Württemberg seine
Herrschaft mit einem wahren Schreckensregiment fort. Jede Opposition wird mit Gewalt
unterdrückt. Adelige, die sich kritisch über den Herzog äußern
oder ihm auch einfach nur zu mächtig erscheinen, werden verhaftet, grausam
gefoltert und schließlich wegen irgendwelcher angeblicher Verbrechen verurteilt
und hingerichtet. Selbst der Vater seiner einstigen Geliebten, Konrad Thumb von
Neudorf, kann sich nur durch Flucht seiner Verfolgung entziehen.
Aber auch das einfache Volk hat unter seinem Terror zu leiden. Der Herzog führt
sich als gnadenloser Richter auf, wahrscheinlich, um einen möglichen neuen
Aufstand gegen ihn schon im Keim zu ersticken.
Nach dem Tod Kaiser Maximilians legt sich Ulrich von Württemberg auch mit
seinem Enkel und Nachfolger, Kaiser Karl V, in den folgenden Jahren immer wieder an.
Er überfällt Städte außerhalb seines Herrschaftsbereichs und
versucht so, sein Einflussgebiet dauerhaft zu vergrößern. Damit sorgt er
für permanente Unruhe in Land des jungen Kaisers.
Doch diese Eroberungszüge sind wenig erfolgreich, denn durch den Mord an Hans
von Hutten hat er sich viele Feinde geschaffen. So finden sich jeweils sehr
schnell einige andere Fürsten, die mit ihren Truppen den überfallenen
Städten zur Hilfe eilen. Ulrich muss wiederholt aus Württemberg fliehen und
wird ein zweites Mal zum Geächteten erklärt.
Dieses ewige Hin und Her endet endgültig erst mit dem Tod des Herzogs am 6. November 1550. Insbesondere bleibt bis dahin die Angst vor seinem Terror - zuletzt verstärkt auch gegen die katholische Kirche gerichtet - für sein Volk allgegenwärtig, so dass die Nachricht von seinem Tod allgemein eher mit Erleichterung aufgenommen wird.
9. 8. 2003
Petra Hannebauer
Quelle: Gustav Radbruch / Heinrich Gwinner "Geschichte des Verbrechens"
K. F. Koehler Verlag Stuttgart, 1951